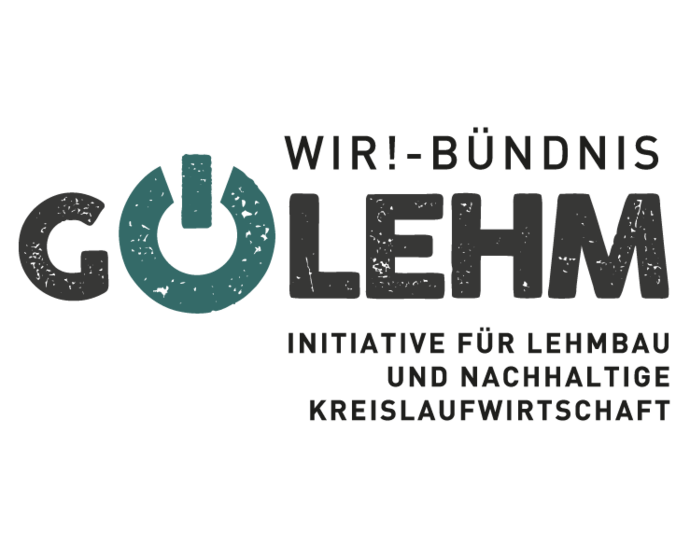EnErLe - Handlungsempfehlungen für die energetische Ertüchtigung von Massivlehmgebäuden

Ziele und Vorgaben
Ziel des Projektvorhabens ist die Entwicklung und Bereitstellung von Handlungsempfehlungen für die energetische Ertüchtigung von Massivlehmgebäuden sowohl in der Sanierung des umfangreichen Gebäudebestands in Mitteldeutschland als auch im Neubau für die Zielgruppen Planende, Behörden und Nutzende.
Innovationsansatz
Derzeit ist kein umfassendes, praxisrelevantes Planungswerkzeug für die energetische Sanierung von Massivlehmgebäuden vorhanden.
Bei den in Deutschland existierenden Massivlehmbauten (geschätzter Bestand mehrere 100.000 Objekte) kommt es bereits zu einem Sanierungsstau.
Gebäude aus Massivlehm werden eher als Problemfall angesehen. Der historische und konstruktive Wert des Materials wird durch die Eigentümer überwiegend nicht erkannt. Zudem sind Planer und Energieberater derzeit (noch) nicht auf Massivlehm geschult. Damit ist fortlaufend mit Verlusten wertvoller Bestandsgebäude zu rechnen.
Aufgabenfelder
Das Vorhaben beinhaltet die 4 Arbeitspakete, Laboruntersuchungen, die Entwicklung von Konstruktionsvarianten und Handlungsempfehlungen, die Entwicklung einer Bewertungsmatrix zur energetischen, ökologischen und ökonomischen Bewertung und schließlich das Vervollständigen und Finalisieren der Handlungsempfehlungen für die energetische Ertüchtigung von Massivlehmgebäuden
Wissenschaftlicher Beitrag
Bei Änderungen an Bestandsgebäuden aus Massivlehm sorgt insbesondere die Forderung des §48 nach Verringerung des Wärmedurchgangskoeffizienten auf den in Anlage 7 des GEG definierten Wertes für Außenwände von U=0,24 W/(m2K) zur Notwendigkeit der Dämmung dieser Bauteile [1] . Historische Wellerlehmwände mit einem mittleren Strohanteil weisen hingegen bei einer üblichen Wandstärke von 60 cm einen U-Wert von ca. 0,85 W/(m2K) auf und schwere Stampflehmwände mit 50 cm Dicke sogar nur einen Wert von ca. 1,35 W/(m2K). Schnell sind hier sogar die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz gemäß DIN 4108 weit überschritten. Die Reduzierung des Transmissionswärmeverlustes durch die energetische Ertüchtigung des Bestandes ist also wichtig. Jedoch erfordert Lehm als tragender Baustoff eine spezifische Betrachtung, die bei einer reinen Befolgung von Höchstwerten aus Gesetzesvorgaben schnell außer Acht geraten kann.
Bei Nichtbeachtung grundsätzlicher konstruktiver Zusammenhänge erhöht sich die Schadenswahrscheinlichkeit. Insbesondere, wenn Lehmwände mit Strohanteil versehen sind (Wellerlehmwände), kann die Auswahl eines nicht diffusionsfähigen Dämmstoffes und Außenputzes die Gefahr von Feuchteschäden in der Wand steigern, die mittelfristig durch Zersetzung des Strohs und Feuchtestau im Lehm zu Festigkeitsverlusten der Wand führen. Eine falsche energetische Ertüchtigung kann also zur Beeinträchtigung der Standfestigkeit historischer Massivlehmwände führen und so die positive Wirkung einer ursprünglich substanzerhaltenden und energiesenkenden Sanierungsmaßnahme in das Gegenteil verkehren. Bei der Vielzahl an anstehenden Instandhaltungen dieses besonderen Gebäudebestandes droht bei unwissendem Handeln durch Eigentümer, Planer und Ausführende ein massiver materieller und finanzieller Schaden.
Bei einer komplexen Sanierung von Masivlehmgebäuden können spezifische Handlungsempfehlungen für massive Lehmbauten fehlerhafte Entscheidungen gerade in der Anfangsphase eines Projektes vermeiden. Die Planenden werden auf die konstruktiven Zusammenhänge zwischen Wärmeschutz, Feuchteschutz und Tragverhalten des Lehms hingewiesen und können so bei einer energetischen Gesamtbetrachtung des Sanierungsvorhabens gesetzliche Forderungen und konstruktive Notwendigkeiten in Einklang bringen und dabei auch passende Kompensationsmöglichkeiten finden.
Allgemein verständliche Handlungsempfehlungen sollen auch Eigentümern zu Gute kommen, die lediglich die Instandsetzung ihrer Außenwände umsetzen möchten, ohne eine Gesamtsanierung ihres Gebäudes anzustreben. Denn auch hier greifen die Vorgaben des GEG zum Maximalwert des Wärmedurchgangskoeffizienten im Sinne einer Einzelbauteilbetrachtung. Nur selten werden Fachleute für die Planungen solcher Maßnahmen an tragenden Bauteilen aus Lehm beauftragt und bei der Ausführung kommen oft ungeeignete Standardprodukte für den Mauerwerksbau zum Einsatz. Angaben von Baustoffherstellern zum Einsatzgebiet ihrer Dämmprodukte und Außenputzsysteme sind dabei meist unzureichend. Ein Handlungsleitfaden kann so Eigentümer über die Besonderheiten ihrer Immobilie sensibilisieren und gerade bei fehlendem Fachwissen beratende Funktionen übernehmen.